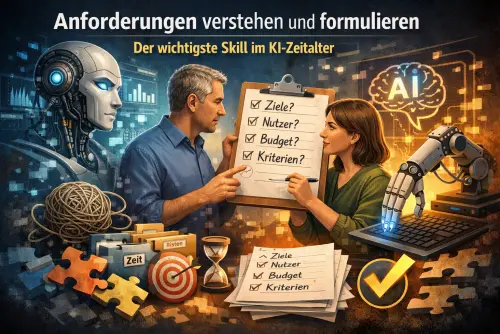Schönheit kann im Studium Vorteile bringen zumindest im Hörsaal. Einer Studie aus 2022 zufolge profitieren attraktive Studierende in Präsenzkursen von besseren Noten allerdings nur, solange man sie sieht. Bei Online-Unterricht verschwindet dieser “Schönheitsbonus” bei Studentinnen, während ihre attraktiven männlichen Kommilitonen weiter überdurchschnittlich abschneiden. Die Ergebnisse legen nahe, dass hinter dem Vorteil von Schönheit bei Frauen vor allem unbewusste Bevorzugung durch Lehrende steckt und bei Männern eher echte Leistungsfaktoren.
Attraktivität und Leistung
Physische Attraktivität beeinflusst nachweislich den Erfolg im Leben – gutaussehende Menschen sind oft zufriedener, verdienen mehr und schneiden besser ab. Unklar ist jedoch, warum dieser “Schönheitsbonus” entsteht. Eine Erklärung sieht darin eine unbewusste Bevorzugung attraktiver Personen (Diskriminierung), während eine andere auf tatsächliche Vorteile durch Attraktivität abstellt, etwa höheres Selbstbewusstsein oder bessere soziale Fähigkeiten.
Bisher gab es kaum Forschung zu diesem Phänomen im Hochschulbereich. Der Ökonom Adrian Mehic von der Lund Universität in Schweden hat diese Lücke geschlossen und untersucht, wie sich äußerliche Attraktivität von Studierenden auf deren Noten auswirkt. Seine neue Studie nutzte die Umstellung auf Online-Lehre während der Corona-Pandemie als natürliches Experiment, um den Einfluss von Schönheit auf Studienleistungen genauer zu beleuchten.
Schönheitsbonus im Hörsaal
Als Datengrundlage dienten Noten von fünf Jahrgängen eines schwedischen Ingenieurstudiengangs mit insgesamt 307 Studierenden. Zunächst betrachtete Mehic die regulären Präsenzsemester vor der Pandemie. Dabei zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen Aussehen und Studienerfolg: Attraktivere Studierende erzielten in Fächern mit viel persönlicher Interaktion signifikant bessere Noten. Solche nicht-quantitativen Kurse – etwa Betriebswirtschaft oder Marketing – umfassen Seminare, Präsentationen und Projektarbeiten und bieten engen Kontakt zu Lehrenden. In quantitativen Fächern wie Mathematik oder Physik mit überwiegend schriftlichen Prüfungen gab es hingegen keinen messbaren Attraktivitätsvorteil. Dieser Schönheitsbonus in Präsenz zeigte sich bei weiblichen wie männlichen Studierenden gleichermaßen.
Diskriminierung oder Selbstbewusstsein?
Der geschlechtsspezifische Unterschied bei der Online-Lehre erlaubt einen Schluss auf die Ursache des Schönheitsbonus: Bei weiblichen Studierenden beruhte der Vorteil offenbar auf unbewusster positiver Diskriminierung durch die Lehrenden – wenn das attraktive Äußere nicht mehr sichtbar war, entfiel auch die Sonderbehandlung. Bei männlichen Studierenden dagegen scheint Attraktivität mit Eigenschaften einherzugehen, die unabhängig vom direkten Sichtkontakt zu besserem Abschneiden beitragen. Laut Mehic kommen hier beispielsweise höheres Selbstvertrauen, Beharrlichkeit und ausgeprägte soziale Fähigkeiten zum Tragen. Diese Eigenschaften könnten in diskussions- und projektbasierten Kursen nützlich sein und erklären, warum attraktive Männer selbst ohne persönlichen Kontakt weiter leicht im Vorteil blieben.
Attraktivität objektiv vermessen
Wie wurde “Schönheit” hier gemessen? Mehic verwendete Porträtfotos aller Studierenden und ließ deren Attraktivität von unabhängigen Personen beurteilen. Im Schnitt bewerteten 37 externe Personen jedes Gesicht auf einer Skala; aus diesen Urteilen berechnete die Studie einen standardisierten Attraktivitätsindex. Die hohe Übereinstimmung zwischen den einzelnen Bewertungen spricht für eine zuverlässige Messung. Durch dieses objektive Vorgehen war sichergestellt, dass nicht die subjektive Wahrnehmung der Lehrenden den Schönheitsfaktor bestimmte. Gleichwohl ist die Untersuchung in ihrem Kontext begrenzt: Sie betrachtet nur das Grundstudium eines einzelnen Studiengangs mit 307 Studierenden. Trotzdem bieten die Befunde einen selten klaren Einblick in bisher wenig beleuchtete Einflussfaktoren auf Bildungsgerechtigkeit.
Fazit
Die Arbeit von Herrn Mehic stützt die These des „Pretty Privilege“. Auch wenn die Studie bereits drei Jahre alt ist, weckt sie Erinnerungen an frühere Untersuchungen, die zeigen, dass Schönheit in der Gesellschaft unfaire Vorteile verschafft. Besonders in der Bildung ist das bitter, denn diese unbewusste Wahrnehmungsverzerrung könnte attraktiven Studierenden unwillkürlich bessere Leistungen zuschreiben. Für mich ist das ein Hinweis darauf, dass unser jetziges Bildungssystem Schwächen hat und reformiert werden muss. Wir sollten stärker darauf achten, dass Menschen so gut wie möglich gebildet werden und nicht in veralteten Theorien verharren, die komplexe Systeme mit einer simplen Zahlenskala bewerten aka das Schulnotensystem.